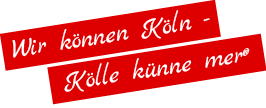Wissenswertes über Köln
Heinzelmännchen zu Köln
Die Heinzelmännchen
Nachts kamen einst fleißige Heinzelmännchen, kleine Männchen mit Bärten und Zipfelmützen, zu den Kölner Handwerkern und erledigten heimlich deren Aufgaben. So lebten die Kölner mit ihren Hausgeistern glücklich und ohne viel Arbeit, bis eines Tages die neugierige Schneidersfrau den Männchen auflauerte, sie mit Erbsen zu Fall brachte und mit einer Laterne erschrak.
Die Kölner und die Heinzelmännchen
Die Männlein ergriffen die Flucht und kamen nie wieder! Die Kölner mussten von nun an ihre Arbeit selbst verrichten, so beschreibt es die Sage, die den Maler und Dichter August Kopisch 1836 zu einem Gedicht inspirierte. Die Geschichte passt sehr gut zu uns Kölnern, schließlich haben wir das Arbeiten nicht erfunden, d.h. Ordnung und Fleiß gehören nicht unbedingt zu unseren Kernkompetenzen.
Der Heinzelmännchenbrunnen
Der Kölner Verschönerungsverein setzte August Kopisch und den Heinzelmännchen 1899 ein Denkmal. Die Steinmetze Edmund (der Ältere, Vater) und Heinrich Renard (Sohn) schufen den Zierbrunnen "Am Hof". Heinrich fungierte dabei auch als Architekt. Zum 100-jährigen Bestehen wurde das neugotische Denkmal umfassend restauriert, dabei wurde die neugierige Schneidersfrau ins Stadtmuseum gestellt und durch eine gelungene Kopie ersetzt. Ihre streng preußische Gestalt ist typisch für die Entstehungszeit. Ebenfalls ist die Botschaft des Brunnens eine Warnung vor der Neugierde, eine Meerkatze oben auf dem Brunnen bestärkt dies. Die Meerkatze symbolisiert, dass die Versuchung des Teufels ständig da ist. Die Reliefs aus Sandstein wurden durch witterungsbeständigere Kopien ausgetauscht. Das Brauhaus "Früh am Dom" hat mit einer Patenschaft für den Brunnen wesentlich zur Sanierung beigetragen.
Ursprung und wahrer Kern der Geschichte
Vor Veröffentlichung des Gedichts von August Kopisch wurde bereits 1826 die ursprünglich rheinische Sage aus dem Siebengebirge vom Kölner Schriftsteller und Lehrer Ernst Weyden als Erzählung niedergeschrieben. Ein plausibler Hintergrund der Kölner Heinzelmännchen-Sage war folgender: Die Heinzel-Männchen waren kleinwüchsige Menschen oder auch Kinder, die im rechtsrheinischen Bergbau tätig waren. Die durch Defizite in der Ernährung klein gebliebenen Menschen (auf Kölsch: Männchen), schöpften ursprünglich als Wasserknechte mit Ledereimern Grubenwasser aus Bergwerksstollen. Eine Zipfelmütze aus Filz mit Stroh ausgestopft diente dabei als früher Arbeitsschutz wie ein Schutzhelm. Im 16. Jahrhundert wurde zur Entwässerung der Bergwerksstollen eine Wasserhebemaschine erfunden, die Heinzenkunst hieß. Der Begriff "Heinzen" bedeutete Grubenwasser ziehen. Diese Wasserhebevorrichtung machte die Heinzel-Männchen als Wasserknechte aus dem Bergischen Vorland und dem nahen Siebengebirge weitgehend arbeitslos. Ein anderes Problem war, dass im 16. Jahrhundert Handwerker nur dann tätig sein durften, wenn sie in einer Zunft organisiert waren. Als Legitimation, dass die Zunftordnung eingehalten wurde diente als Zunftschmuck ein goldener Ohrring mit dem jeweiligen Handwerkerwappen. Dieser galt gleichzeitig als Notgroschen und sorgte für ein ordentliches Begräbnis, wenn ein Geselle auf der Walz verstarb. Gesellen, die sich was zu Schulden kommen ließen, entfernten man den Zunftring gewaltsam vom Ohr. So wurde man als Schlitzohr gekennzeichnet. Die "Heinze-Männchen" durften in Köln ohne Zunftring nicht arbeiten, daher arbeiteten sie heimlich im Dunkeln. Nachts wurde auch früher schon "schwarz" gearbeitet, dabei nutzen die städtischen Handwerker die Not der illegalen Arbeiter und Kinder aus. Fast alle waren Analphabeten und hatten natürlich keinen Arbeitsvertrag, demzufolge gab es dann für die emsigen Nachtarbeiter morgens oft nicht nur sprichwörtlich lediglich einen Apfel und ein Ei. Erst nach der französischen Revolution besserte sich die Situation von Kindern und Landbevölkerung. Eine weitere Verbesserung für heutige Heinzelmännchen stellt zweifellos der 2015 in Deutschland eingeführte Mindestlohn dar.
Weitere Sagen und moderne Heinzelmännchen
Bevor August Kopisch Dichter wurde, war er zunächst Maler. Als ein sehr guter Schwimmer entdeckte er 1826 die Blaue Grotte auf Capri.
Ein Heinzelmännchen fand in "Donewald" (Dünnwald) Zuflucht. Aus Dank stellte er Grinken her, eiserne Reifen für Holzräder. Dem Grinkenschmied ist seit 1976 in Höhenhaus ein Bronzedenkmal gewidmet. Die Geschichte hat ihren Ursprung aus Westfalen.
Huppet Huhot humpelte und wurde von Knechten gehänselt, aus Rache trieb er Schabernack auf einem Kölner Bauernhof. Mit seinem Huhot (hoher Hut) hatte er eine Art Tarnkappe und konnte sich verstecken. Mit einem Kegelspiel hat man ihn in die Wahner Heide ausgebürgert. Donnert es heute, spielt Huppet Huhot wieder kegeln, sagen wir noch heute.
In die Filmwelt schafften es die Heinzelmännchen sogar 2-mal, 1956 und 2019. Auch im Fernsehen tauchen sie auf: In Anlehnung an die Heinzelmännchen nannte man zunächst die Mitarbeiter des ZDF mit Sitz in Mainz (1963) Mainzelmännchen. Daraus wurden die auch heute noch beliebten Zeichentrickfiguren im Werbefernsehen.
Unvergessen ist ein Auftritt der Heinzelmännchen im Hänneschen Theater. Hier standen sie sogar einmal vor Gericht und mussten großes rhetorisches Talent aufbringen, um ihre Haut vor dem Galgen zu retten.
Die Künstlerin Heike Haupt und der Künstler Anton Fuchs brachten im laufe der letzten Jahre 24 verschiedene Heinzelmännchen (in Form von 35 cm großen Bronzestatuen) (https://www.heinz-welt.de/) in die Stadt. Heinz Koffer steht z.B. am Hilton, Heinz Köbes am Brauhaus Peters und am Gürzenich sind Heinz Jung, Heinz Einmal und Heinz Bauer als Dreigestirn verewigt. Die Heinzelmännchen sind also wieder in der Stadt und lassen sich diesmal hoffentlich nicht so leicht vertreiben.
(ursprünglich veröffentlicht: 2017-05-03)
Günther Klein Dipl.-Wirt.-Ing.