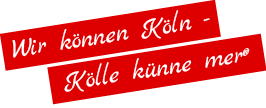Karnevalstour durch köln - die Stadt in der fünften Jahreszeit
humorvoll, typisch kölsch und spannend
Bei dieser einzigartigen Karnevalsführung mit einem echten kölschen Jeck erfahren Sie vieles über die Herkunft und Bedeutung der rheinischen Karnevalsbräuche und lernen die wichtigsten Karnevalstraditionen kennen.



Infos und Preise
Karnevalstour durch köln - die Stadt in der fünften Jahreszeit| Dauer: 1,5 Stunden | |
| Start: Bahnhofsvorplatz | |
| Ende: Fischmarkt | |
|
Gruppenpreis: bis 12 Pers.: 180 € inkl. MwSt. Kostenfrei anfragen Anfrage Gruppen |
|
|
Öffentliche Führung 14 € pro Person inkl. VRS (12 € p. P. ermäßigt) Öffentliche Führung |
|
Verfügbare Termine |
|
| max. 24 Personen | |
| verfügbar im Jan. und Feb. | |
Ähnliche Führungen
Ganz Köln schunkelt und feiert in der fünften Jahreszeit
Alljährlich am 11. November setzt in Köln die übliche Zeitrechnung aus und die fünfte Jahreszeit bricht an: Mit der Sessionseröffnung um 11.11 Uhr beginnt der Karneval und gängige Regeln und Konventionen werden - mit einer Unterbrechung in der Weihnachtszeit - bis zum Aschermittwoch außer Kraft gesetzt. Karneval ist das Fest der Sehnsüchte: In der Phantasie ist alles möglich. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Eröffnung des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht und der Rosenmontagszug, der jährlich hunderttausende Besucher aus der ganzen Welt in die Domstadt lockt. Fantasievoll verkleidete Narren bestimmen das Stadtbild und ganz Köln schunkelt und singt in feuchtfröhlicher Feierstimmung, die traditionell am Aschermittwoch endet.
Ein echter kölscher Jeck führt Sie durch den Karneval
Bei unserer Karnevalsführung hören Sie spannende und amüsante Geschichten von den Ursprüngen der Feierlichkeiten und besuchen Orte, an denen Karnevalsgeschichte geschrieben wurde. Lernen Sie das Kölner Dreigestirn kennen und hören Sie, warum die Kölner Jungfrau immer noch ein Mann ist. Auch das Funkenmariechen war einst ein Mann, heute ist ihr wichtigstes Utensil ein Schaschlikspieß. Warum? Unsere Karnevalstour hat die Antwort. Erfahren Sie etwas über die Bedeutung von Geisterzug und Stunksitzung, und warum Sie besser die Finger von der kalten Ente lassen sollten. Wir verraten Ihnen auch, wo Sie bei einer Karnevalssitzung Kölsch trinken können.
Das Karnevalsmotto
Jedes Jahr steht der Kölner Karneval unter einem besonderen Motto. Das "Sessionsmotto" für das Jubiläumsjahr 2023 lautet: "Ov krüzz oder quer". Ov krüz oder quer, ov Knäch oder Hähr, mer looße nit un looße nit vum Fasteleer" (aus Refrain Volkslied: "E Johr eß vergange" von Emil Jülich 1905). "Uns Sproch es Heimat" lautete das Motto 2019. Die kölsche Sprache gehört einfach zum Karneval. Auch wenn im Alltag immer weniger Kölsch gesprochen wird, beim Singen ist Kölsch sehr präsent. Das vergangene Motto "Mer stelle alles op der Kopp" war eine Einladung, sich selbst zu hinterfragen oder etwas Neues anzufangen. Es war auch eine Möglichkeit über ein weibliches Dreigestirn nachzudenekn. Mit "Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck!" standen natürlich die Kinder im Mittelpunkt. 2018 sind wir dann aus der Reihe getanzt. 1823 lautete das Motto: Thronbesteigung des Helden Carneval.
Bitte beachten Sie auch unser Karnevalslexikon weiter unten auf der Seite.
KARNEVAL OP KÖLSCH – EIN KÖLSCHES FEST, NICHT NUR FÜR KÖLNER!
Dreimal „Kölle Alaaf“! Wenn dieser Schlachtruf, der „Hoch lebe Köln!“ bedeutet, jedes Jahr aufs Neue am 11.11. um 11:11 Uhr zu hören ist, setzt in Köln die übliche Zeitrechnung aus und die fünfte Jahreszeit bricht an. Zur Weihnachtszeit gibt es eine kurze Unterbrechung des Sitzungskarnevals, denn auch die Jecken genießen die besinnliche Adventszeit.
Die Wurzeln des Karnevals
Entstanden ist der Karneval im Mittelalter, im 14. Jahrhundert, als sich das Christentum im Rheinland zur Hauptreligion mit vielen strengen Regeln entwickelt hatte. Aber ein ganzes Leben voller Vernunft und Gehorsam ist anstrengend. Deshalb braucht man eine Auszeit, und mit der "Sessionseröffnung" werden übliche Konventionen außer Kraft gesetzt. In Köln spielt man dann verrückt und wird „jeck“. Der Karneval hat auch anarchische Wurzeln, der Bürger darf als Narr die Obrigkeit kritisieren.
Wann beginnt Karneval?
Der Beginn des Karnevals hängt mit dem Osterfest zusammen: Genau 40 Tage vor Ostern endet mit dem Aschermittwoch die Karnevalssession. Da Ostern nach dem ersten Vollmond im Frühjahr gefeiert wird, hat der Karneval kein fixes Datum. Der Aschermittwoch läutet dann die 40-tägige Fastenzeit ein, dabei werden Sonn- und Feiertage ausgenommen. In Köln wurde die Fastnacht zum ersten Mal 1341 n. Chr. schriftlich erwähnt. Am 11. im 11. wird schon mal geprobt, vor allem die Musiker, der "Sessionsstart" im November wird erst seit 1967 gefeiert. Ursprünglich geht der 11. November auf den Martinstag (Lehnsabgabe und letzter Tag vor der früheren zweiten Fastenzeit) zurück
6 Tage Rennen - einmal anders
Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Eröffnung des Kölner Straßenkarnevals an Weiberfastnacht um 11:11 Uhr (Beginn um 9:00 Uhr) auf dem Alter Markt. Hinzu kommt der Rosenmontagszug, der jährlich hunderttausende Besucher aus der ganzen Welt in die Domstadt lockt. Phantasievoll verkleidete Narren bestimmen das Stadtbild und ganz Köln schunkelt und singt in feuchtfröhlicher Feierstimmung. Um Mitternacht am Karnevalsdienstag wird der berühmte „Nubbel“ verbrannt – eine als Mensch verkleidete Strohpuppe. Symbolträchtig muss er dabei stellvertretend für das sündige Leben der Jecken büßen. Am Aschermittwoch ist dann alles vorbei und das normale Leben hält wieder Einzug in Köln. Traditionell wird am Aschermittwoch in geselliger Runde Fisch mit Butter gegessen und dazu Kölsch getrunken – alles klassische Fastenspeisen.
Kölsche Traditionen im Karneval
Ursprünglich waren die Festkomitees reine Herrengesellschaften. Heute sind es neben den neun Traditionskorps auch viele Familiengesellschaften. Mittlerweile gibt es auch reine Damen- und Schwulengesellschaften. Die Gesellschaften pflegen kölsches Brauchtum und die kölsche Sprache. Elf Personen, die meist zum Vorstand gehören, bilden in einer Karnevalsgesellschaft den Elferrat. Während einer Sitzung unterstützen sie den Präsidenten. Heute stehen die Sitzungsredner lieber frei auf den Bühnen, während früher die „Bütt“, eine Art Rednerkanzel, Tradition war. Prinz, Bauer und Jungfrau bilden seit 1883 eine symbolische Einheit als Kölner Dreigestirn. Aus dem früheren König oder „Held Carneval“ wurde 1871 der Prinz Karneval, der im Mittelpunkt des Volksfestes steht. Seine Pritsche steht als Symbol der Herrschaft und ist Gegenstück zum Zepter. Der Bauer steht metaphorisch für die Mitgliedschaft von Köln in der Reichsbauernschaft im Mittelalter. Bei der Proklamation erhält er symbolisch vom Oberbürgermeister den Stadtschlüssel, mit Schild und Dreschflegel steht er für die Wehrhaftigkeit der Stadt. Die kölsche Jungfrau verkörpert die freie Stadt Köln, die immer unabhängig war und keiner fremden Macht unterworfen wurde. Ihr Spiegel symbolisiert die Schönheit der Stadt, die Mauerkrone die Unverletzlichkeit. Auch ihre Rolle wird traditionsgemäß von einem Mann übernommen, da ursprünglich die Karnevalsvereine reine Herrengesellschaften waren. Auch heute noch sind die neun Traditionskorps reine Männervereine. Zum offiziellen Karneval zählen natürlich auch viele Familiengesellschaften. Die Vereinskultur hat neben der Brauchtumspflege und der Jugendförderung auch häufig einen starken sozialen Charakter.
Ein Küsschen in Ehren
Im Kölner Karneval wird natürlich auch "jebützt", ob man sich kennt oder nicht. Ein „Bützje“ ist ein freundschaftliches Küsschen mit gespitzten Lippen auf die Wange. Ganz früher war das "Bützje" sittenwidrig.
Ob jung oder alt, in Köln kommt während der Session jede Generation auf verschiedenste Weise auf ihre Kosten.
Alternativer Karneval
In der Stunksitzung richtet ein Ensemble von verschiedenen Künstlern seit 1984 einen kabarettistischen Blick auf das aktuelle Tagesgeschehen, die Stadt Köln, die Kirche und auch auf den offiziellen Karneval. Wenn Sie den Ausruf „Kölle Aloha“ hören, dann befinden Sie sich auf der Rosa-Sitzung. Die kabarettistische Schwulen- und Lesbensitzung, die durch Hella von Sinnen und Georg Uecker bekannt wurde, findet im Gloria Theater statt. Auch Heteros sind herzlich willkommen. Neben den großen Sitzungen im Gürzenich, Sartory oder Maritim finden noch viele weitere alternative Veranstaltungen statt, wie z. B. Fatal Banal, Deine Sitzung, die Sitzungen der leisen Töne, Kneipensitzungen, Nostalgiesitzungen, Kindersitzungen etc.
"Dat jitt et nur en Kölle"
Reine Damengesellschaften z. B.: "Colombina Colonia", "Die Schmuckstückchen", "De kölsche Madämche", "Foyer", "Goldmarie" sind auf dem Vormarsch. Wir warten auf das erste reine Damendreigestirn!
Auch der 1. FC Köln ist seit 2015 offizielles Mitglied im Festkomitee Kölner Karneval, eine Ausnahmeregelung macht den Fußballclub auch zum Karnevalsverein.
Gemäß dem Motto der Bläck Fööss „Drink doch eine met“ lässt sich während des Kölner Karnevals auch die ein oder andere neue Freundschaft schließen.
Unsere Tipps, damit Sie die Karnevalszeit genießen können:
- seien Sie so früh wie möglich da
- lassen Sie Ihre Wertsachen zuhause
- selbst gestaltete Fantasiekostüme sind optimal
- bedenken Sie bei der Wahl des Kostüms auch, dass draußen zwar noch Winter ist, in den Lokalitäten aber eher tropische Temperaturen herrschen
- lassen Sie sich von einem erfahrenen Karnevalisten oder Kölner begleiten
- geben Sie auch mal einen aus
Kölner Karneval in Zahlen - WIEVIEL UMSATZ BRINGT DER KÖLNER KARNEVAL UND WAS KOSTET ER?
Karneval in Köln bedeutet jährlich fast 1.000 Millionen € Gesamtumsatz (ca. Werte nur Köln und ganze Session): Für Kostüme und Accessoires werden alleine ca. 150 Millionen ausgegeben. Die gastronomischen Betriebe setzen ca. 400 Millionen € um und bewirten ca. 1 Million Besucher, die natürlich auch die Sitzungen und Bälle besuchen. Auch der öffentliche Nahverkehr, Taxen und Fluggesellschaften sowie Hotelbetriebe profitieren vom Kölner Karneval. Zur Karnevalszeit schnellen sogar die Friseurbesuche hoch. 300 Tonnen Kamelle werden jedes Jahr geworfen, ebenfalls ca. 300.000 "Strüßjer" (Blümchen). Die Stadt profitiert von der Gewerbesteuer (Schätzung: ca. 5 Millionen), wobei auch ca. 4 Millionen für Sauberkeit und Sicherheit im Straßenkarneval als Zuschuss wieder verschwinden. Die Ausgaben für Sicherheit sind in den letzten Jahren gestiegen. Beim Rosenmontagszug werden bei gutem Wetter über 1 Million Zuschauer gezählt. (Stand: 2024, Quelle: Statista und IW). Hinzuzufügen ist noch, dass sich viele Kölner im Karneval ehrenamtlich engagieren und dass der Rosenmontagszug in Köln frei von Werbung ist.
Wie wird man Prinz? Wir wird man Dreigestirn?
Prinz, Bauer und Jungfrau sollten aus einer ordentlichen Gesellschaft des Festkomitees kommen. Meist kommen sie aus einer Gesellschaft, jedoch ist es nicht obligatorisch. Zunächst gilt es sich bei der eigenen Gesellschaft zu bewerben, der Präsident wird involviert und ein Konzept wird vorgestellt. Beim Festkomitee wird dann eine schriftliche Bewerbung eingereicht. Danach gibt es mehrere Interviews, es wird geprüft ob Prinz, Bauer oder Jungfrau auch mit Job und Familie zusammen passen. Stressresistenz, Eloquenz, polizeiliches Führungszeugnis und mehrjährige Zugehörigkeit im Ehrenamt müssen Stimmen. Auch die Finanzen sollten stimmen, schließlich entstehen Kosten im mittleren fünfstelligem Bereich. Stimmt das Festkomitee zu, kommt es zum geheimen "Nickabend", d.h. die OBin oder der OB nicken als Stadtoberhaupt ab. Verschwiegenheit ist bis zur Pressekonferenz im spätsommer angesagt, danach werden die NAmen bekannt gegeben. Am 11. im 11. steht das Trifolium schon mal auf der Bühne, noch ohne Ornat versteht sich. Erst nach der Übergabe der Insignien: Pritsche, Stadtschlüssel und Spiegel bei der Prinzelproklamation im Januar im Gürzenich glänzen sie im vollen Ornat und sind damit offiziell im Amt. Vorher sind noch Tanz- Redekurse zu besuchen ebenfalls Atem- und Interviewtraining und wenn nötig Kölsch Kurse zu absolvieren. Wir warten auf das erste weibliche Dreigestirn, ordentliche Damengesellschaften gibt es ja.
KARNEVALSLEXIKON
Hier finden Sie ein Karnevalslexikon mit Erläuterungen zu den wichtigsten Begriffen aus dem Kölner Karneval. Das Lexikon iefert einen guten Überblick über Worte, Formulierungen und Ausdrücke, die eng mit dem Kölner Karneval oder rheinischem Karneval verbunden sind.
Alaaf: Von all-aff (kölsch) bzw. all ab, dies bedeutet alle Konzentration auf Köln, Alaaf ist der Narrenruf zur Begrüßung und dient zur Kommunikation mit dem Publikum bei den Sitzungen. Der Begriff "Allaf" ist seit dem 16. Jahrhundert bekannt, der Trinkspruch auf einem Krug "Allaf fur einen goden druinck" heißt so viel wie "Nichts geht über einen guten Trunk".
Altstädter Köln 1922 e.V.: Persiflieren Kurköln (rot und grün), eröffnen den Straßenkarneval an Weiberfastnacht
Appelsinefunke: Kölner KG Nippeser Bürgerwehr 1903 e.V., Kosename wegen ihrer orange-weißen Uniformen, eröffnen Weiberfastnacht den Karneval auf dem Wilhelmsplatz in Nippes bereits um 9:11 Uhr
Bauer: (s.auch "Boor") Symbolische Figur aus dem Ständesystem, steht für die Wehrhaftigkeit und Reichstreue der Stadt. "Halt fass do kölsche Boor. Bliev beim Rich et fall sös ov sor." ("Bleib' beim Reich, Du kölscher Bauer. Mag es kommen süß oder sauer."). Köln war im MA Mitglied in der Reichsbauernschaft. Seine Pfauenfedern stehen für die Wehrhaftigkeit und Unsterblichkeit der Stadt. Sein Insignien sind die Stadtschlüssel. "Pass god op uns Stadt op"
Bellejeck: mittelalerlicher Narr mit Glöckchenkostüm, mit Till Eulenspiegel verwandt
Bibi: Antike schwarze Melone, wurde früher gern im Karneval getragen
Blaue Funken: Kölner Funken Artillerie blau-weiß von 1870 e.V., Traditionskorps, berittene Artillerie, gehen als Erste ("han de Spetz") im Rosenmontagszug, 1870 aus Spaltung der Roten Funken hervorgegangen
Boor ov Buur: Der Kölsche Bauer ist seit 1871 fest im Dreigestirn. Die Figur geht zurück auf den mittelalterlichen Bauernstand. Er verkörpert mit Schild und Dreschflegel die Reichsverbundenheit und Wehrhaftigkeit der Stadt. Seine Insignien sind die Stadtschlüssel
Bütt: Rednerpult in Form eines Fasses oder Waschbütte. Im Schutz der Bütte durfte die Obrigkeit ironisch humorvoll kritisiert werden, hier kann schmutzige Wäsche gewaschen werden.
Büttenrede: Humorvolle Rede auf Kölsch, ursprünglich in Reimform
Bützje: Flüchtiges Küsschen auf die Wangen mit spitzen Lippen
Carne vale bzw. carne levare: Fleisch, lebe wohl, Start der österlichen Fastenzeit (Aschermittwoch)
Carneval ov Karneval: Begriff seit Ende des 18. Jahrhunderts für Karneval abgeleitet aus dem Lateinischen Carne vale bzw. carne levare
Colombina Colonia e.V. 1. Kölner Damen-Karnevalsgesellschaft gegründet 1999 und förderndes Mitglied im Festkomitee
Divertissementche: Opernparodie auf Kölsch, theatralisch vom Kölner Männer Gesangverein Cäcilia Wolkenburg interpretiert und dargeboten. Im Volksmund "et Zillche"
Dreigestirn: Siehe Trifolium oder unter Prinz, Bauer und Jungfrau.
EhrenGarde der Stadt Köln 1902 e.V.: Begleiten Bauer und Jungfrau, wegen ihrer grün-gelben Uniform werden sie "Spinat met Ei" genannt. Ihr Schlachtruf lautet "Rubbedidupp!". Das bedeutet im Nu und ist alter ein Reitergruß.
Elf: Jecke Zahl als Narrensymbol, heidnische Zahl vorbei an den zehn Geboten und den zwölf Aposteln. Start der Karnevalsaison am 11. im 11. um 11:11 Uhr und Elferrat
Elferrat: Gruppe, meist aus elf Personen (ursprünglich neun, intern können es auch mehr als elf Personen sein), die in Karnevalsgesellschaften organisatorische Aufgaben übernehmen und bei Sitzungen links und rechts vom Präsidenten sitzen. Oft sitzen die Vorstandsmitglieder eines Karnevalsvereins im Elferrat, verdiente Vereinsmitglieder oder prominente Bürger können auch im Elferrat sitzen.
Elfte im Elften: Karnevalsbeginn, seit 1967, ursprünglich Möglichkeit für die Karnevalsbands, ihre neuen Lieder vor Publikum zu präsentieren, daher war die Hauptbühne bis 2021 ohne Eintritt. Eröffnung durch die Willi Ostermann Gesellschaft. Ursprünglich am Ostermannbrunnen, Zwischenstation an der Rathaustreppe, ab 1987 auf dem Alter Markt und seit 2004 auf dem Heumarkt. Der 11. November geht zurück auf den Martinstag, Pacht wird fällig und letzter Tag vor der Adventsfastenzeit (bis 1917 römisch katholischen Kirche).
Fastelovend: Ursprünglich Fastenabend vor Aschermittwoch also Karnevalsdienstag, Begriff ist seit dem Mittelalter im Rheinland bekannt
Fasteleer: Karnevalsdienstag bzw. der Zyklus von Weiberfastnacht bis Karnevalsdienstag
Festkomitee früher Festordnendes Comité: Interessenvertretung von über 100 Karnevalsgesellschaften, ursprüngliches Ziel: Kultivierung des Karnevals, dieser war bis Anfang des 19. Jahrhundert aus den Fugen geraten.
Flüstersitzung: Veranstaltung der Großen Kölner KG mit leisen und nostalgischen Tönen
Foyer - Garderobe Bei Sitzungen gibt es hier Kölsch zu trinken.
Funk: Historisch trugen die Kölner Stadtsoldaten einen roten Waffenrock, der im Dunkeln wie ein Feuerfunke leuchtete. Ein Funk ist ein uniformierter Akteur im Karneval, der das preußische Militär persifliert. Beim Traditionskorps gilt die Maxime: Einmal Funk immer Funk.
Funkenmariechen auch Tanzmariechen: Junges sportliches Mädchen mit Dreispitz, Uniformjacke, kurzem Rock und Spitzenhöschen zeigt akrobatische Tanzeinlagen. Historisches Vorbild waren die Marketenderinnen, die im 17. und 18. Jahrhundert Soldaten begleiteten und dabei Kochen und andere Dienstleistungen anboten. Bis ca. 1930 wurde die Tänzerrolle nur von Männern besetzt. Heute gehört ein männlicher, ebenfalls sportlicher, Tanzoffizier zum Mariechen.
Funkenbiwak: Karnevalsveranstaltung der Roten Funken am Karnevalsamstag auf dem Neumarkt mit Erbsensuppe und Kölsch und Karnevalsprogramm. Die Freiluftsitzung kostet nur geringen Eintritt, damit jeder sich Karneval leisten kann. Das Kölschglas kann mehrfach wieder gefüllt werden.
Geisterzug: Alternativer Karnevalsumzug seit 1991, samstags als politische Demonstration, wechselnde Zugwege. Bereits im 19. Jahrhundert gab es Geisterzüge (Austreibung der Wintergeister) mit viel Lärm. Aktuelle Infos
Gürzenich: Tanz-und Feierhaus, benannt nach der Patrizierfamilie, ursprünglich 1441 in einer Sandgrube errichtet. Neben dem Gürzenich gibt es weitere große Festsäle e.g. Satory, im Maritim, Wolkenburg, Stadthalle Mühlheim etc. Der sog. "Kleiner Gürzenich" war die Kassenhalle der Kreissparkasse am Neumarkt, die Anfang der 1950-er Jahre die im Krieg zerstörten Veranstaltungsstätten z.B. Gürzenich ersetzten.
Hellige Knäächte un Mägde: Älteste Traditionstanzgruppe waren im 1. Rosenmontagszug dabei. Ursprung geht zurück auf die spätmittelalterlichen Bauernbänke mit Reigentanz, sie trugen bei Prozessionen die Heiligenfiguren. Historische Trachten in "rot, weiß und schwarz".
Hofburg: Das Dorint Hotel am Heumarkt ist die Hofburg. Auf der 7. Etage gibt es zehn Zimmer, davon drei Suiten für das Dreigestirn (Trifolium), Prinzenführer, Chef de Equipe und Adjutanten, Anfang Januar ziehen sie ein. Es wird standesgemäß geflaggt: Ehrengarde, Prinzengarde und Festkomitee. Die Hotelkette wirbt mit "kölschen Büdchen" bundesweit für den Kölner Karneval. Fast 50 Jahre lang war vorher ein Hotel an der Helenenstraße die Hofburg.
Jan und Griet Das Reiterkorps "Jan von Werth" veranstaltet am Karnevalsdonnerstag (14.11 h), "Spill an dr Vringspooz". Das ist die Legende von Jan und Griet, die Liebesgeschichte ohne Happy-End von einem Knecht und einer Magd spielt im 17. Jahrhundert. Jedes Jahr mit einem neuen Paar und leicht abgewandeltem Drehbuch.
Jeck oder Karnevalsjeck: ein Narr im Rheinland hat eine positive Einstellung zum Humor, er lässt auch mal eine Fünf gerade sein. Im Karneval ist fast jeder ein Jeck und damit positiv verrückt. Ein "halve Jeck" ist eher ein Schimpfwort, kann aber auch humorvoll gemeint sein.
Jeckespill: Karnevalssitzung in diversen Kneipen "Weetschaffssitzung", Schwerpunkt: "Krätzcher, Kölsch un Kalverei" (Tollerei)
Jungfrau: Verkörpert die freie Reichsstadt und soll an die Mutter Colonia (Agrippina) erinnern. Die Zinnenkrone auf dem Kopf steht für die niemals eingenommene Stadtmauer Kölns. Die Rolle der Jungfrau wird traditionell von einem Mann gespielt, da es früher nur reine Herrengesellschaften im Karneval gab. Ihre Insignie ist ein Spiegel für die Schönheit.
Kalte Ente: Bowle aus Sekt, Wein und Sprudelwasser, garniert mit Zitronenscheiben; häufig überteuert und mit Kopfschmerzgarantie
Kamelle: Ursprünglich Karamellbonbons (gebrannter Zucker) und italienisches Hochzeitsgeschenk (confetto), heute Süßigkeiten als Wurfmaterial beim Karnevalsumzug. 1823 wurden Erbsen und Gipsdragees geworfen. Die Idee: Der Prinz beschenkt seine Untertanen.
Kamellebüggel: Beutel für Wurfmaterial
Kaschöttche: ursprünglich Arrestzelle, heute Nottoilette im Rosenmontagszug
Knabüs: wörtlich Knallbüchse, ein Holzgewehr der roten Funken mit Blumen am Ende des Laufs. Die Blumen signalisieren friedliche Absichten. Historisch haben die Kölner Stadtsoldaten; d.h. die Funken, angeblich nie wirklich geschossen. Früher war die Knabüs auch aus Holunderholz selbst gefertigtes Jungenspielzeug.
Knubbel: Untergruppen bei den roten Funken: 1. Streckstrump, 2. Öllig, 3. Dopp, 4. Stoppe
Kölner Mummenschanz: Gedicht von Goethe: 3. Strophe: "Löblich wird ein tolles streben, Wenn es kurz ist und mit Sinn; Heiterkeit zum Erdenleben sei dem flüchtigen Rausch Gewinn" steht am Fastnachtsbrunnen (Gülichplatz)
Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.V.: Persiflieren die alten Kölner Stadtsoldaten mit rotem Waffenrock und weißen Hosen. Im Volksmund heißen sie "Rote Funken", s. auch Funk, Blaue Funken, Prinzengarde.
Kölsche Kippa Köpp e.V. vun 2017: Jüdischer Karnevalsverein in Köln knüpft an einen ehemaligen jüdischen Karnevalsverein von 1922 "Kleiner Kölner Klub" (KKK) an. Der KKK fand mit dem Beginn der Naziterrorherrschaft ein Ende. Schon ab 1823 gehörten einzelne Juden zum Kölner Karneval und waren auch in Ämtern aktiv. Heute sind auch jüdische Mitbürger zusätzlich in anderen Kölner Karnevalsgesellschaften aktiv.
Konfetti: In Venedig wurde "confetto" also Konfekt im Karneval geworfen. Ein deutscher Buchbinder hat aus bunten Papierbögen runde Stücke ausgestanzt, damit war unser heutiges Konfetti Ende des 19. Jahrhunderts geboren.
Krätzche ov Krätzje: a) lustige Erzählung, lustiges Lied; b) Karnevalsmütze, Karnevalsschiffgen
Kritzelköpp: Team von Kreativen (KünstlerInnen, GrafikerInnen ) entwickeln Ideen für die Persiflagewagen
Laberdan: Kopfschmuck (Helm Perücke) der roten Funken, wörtlich: gesalzener Kabeljau
Lachende Kölnarena (früher: Lachende Sporthalle 1965-1998): Größte Karnevalssitzung der Welt, je ca. 10.000 Besucher, Programm ist sehr gut. Kölsch in Pittermännche und Eierlikör sind preiswert, Essen und Trinken können auch selbst mitgebracht werden. Tickets und Informationen.
Literat: Bei Karnevalssitzungen organisiert er die Büttenredner, Musiker und Tanzgruppen. Der Literat plant die Reihenfolge, in der die Künstler bei der Sitzung auftreten.
Literarisches Komitee Rednerschule (Akademie seit 1824) vom Festkomitee für NachwuchskünstlerInnen
Loss mer singe: Einsingen in den Karneval in verschiedenen Kneipen. Dabei wird über den Hit des Abends abgestimmt. Insgesamt gibt es über 30 Kneipen und am Ende steht der Hit der Session. LMS ist ein eingetragener Verein. Termine
Maach dat do fott küss ov Maht dat ehr fottkutt: Verabschiedung von Künstlern in der Sitzung, "Scher(t) dich/euch weg" ist hier eine höfliche Aufforderung.
Motto: Jedes Jahr steht der Karneval unter einem besonderen Motto. Im Jubiläumsjahr 2023 lautet das "Sessionsmotto": "Ov krüz oder quer". Das Karnevalsmotto wurde früher beim Prinzenfrühstück am Karnevalsdienstag bekannt gegeben, heute wird es am Ende des Rosenmontagszug veröffentlicht.
Moritat: Geschichte mit moralischem Appell, oft mit einfacher Melodie auf der Drehorgel (Leierkasten) begleitet oder als Gedicht vorgetragene Schauerballade. Ursprünglich Erzähllied des Bänkelsängers. Heute gibt es vereinzelt und im Karneval wieder Moritatensänger. Die berühmte Moritat vun Jan un Griet ist auf dem Album "Aff un zo" von BAP als Rocklied zu hören.
Muuze ov Muuzemandel: Mürbeteig in Mandelform in Fett gebacken, Karnevalsgebäck im Rheinland
Nickabend:" Das Stadtoberhaupt (OBin oder OB) hat das letzte Wort und nickt das designierte Dreigestirn im Vorfeld ab. Das Treffen ist mehr oder weniger geheim, die Öffentlichkeit darf noch nichts erfahren.
Nubbel: Strohpuppe, die als Sündenbock zum Karnevalsende theatralisch zu Grabe getragen und verbrannt wird (Ursprung Kirmes auf dem Land).
Orden: Auszeichnung für die Karnevalskünstler, ursprünglich als Persiflage auf die militärische Ordensvergabe gedacht. Orden werden jährlich künstlerisch gestaltet und sind eine individuelle Erinnerung an die jeweilige Karnevalssession
Ornat: Maßgeschneiderte Kostüme für Prinz, Bauer und Jungfrau. Der Prinz hat Fasanenfedern, der Bauer Pfauenfedern und die Jungfrau eine Zinnenkrone als Kopfbedeckung. Die teuren Ornate sind aufwendig und traditionell in rot-weiß gehalten. Das Dreigestirn zahlt selbst dafür und behält die Kleidungsstücke.
Pferde im Zug: 270 Pferde sind 2023 im Zug (früher 400), Vorgaben an die Reiterinnen und Reiter: Reitstunden, Gewicht, Handyverbot, zeitliche Begrenzung, Dopingkontrollen und Abstand zu Musikgruppen erhöhen den Schutz für Mensch und Tier.
Plaggeköpp: Fahnen- und Standartenträger gehen oft voran (daher Köpp), e.g. bei der Proklamation. Kölsch: Plagge = Lappen, steht hier verballhornt für die Fahne
Prinz: Der Prinz verkörpert einen gut gelaunten Herrscher. Insignie: Pritsche. Dazu trägt er rote Schuhe mit weißen Schlaufen. Das Prinzenornat gleicht einem reichsstädtischen Fürsten angelegt an die burgundische Mode des auslaufenden Mittelalters. Ursprünglich "Held Carneval", bis die königliche Familie (F.W. III.) mit "Held" nicht einverstanden war, ab 1872 wurde daraus der Prinz Carneval, der ab 1883 von Bauer und Jungfrau flankiert wird.
Prinzengarde: Begleiten den Prinzen im Zug und bei seinen Auftritten, wegen ihrer weißen Uniform werden sie liebevoll "Mählsäck" genannt, auch aus Spaltung der Roten Funken hervorgegangen
Prinzenpritsche: Pritsche oder Klatsche ist ein altes hölzernes Schlaginstrument des Zeremonienmeisters (vergl. Kasperle) um scherzhaft zur Ordnung zu rufen. Im Kölner Karneval ist die Pritsche heute aus Silber und steht für verballhornt für das das Zepter (Herrscherstab).
Prinzenproklamation: Das Dreigestirn wird offiziell ins Amt gehoben, dabei überreicht der Oberbürgermeister/in die Insignien: Prinzenpritsche, Schlüssel für den Bauer und Spiegel für die Jungfrau. Diese Sitzung zur Machtübernahme des Karnevals ist im Januar im Gürzenich, früher mit Abendgarderobe, auch heute gibt es noch viel Prominenz.
Prinzenspange: Ehrenorden, der direkt vom Dreigestirn für besondere Verdienste verliehen wird. Jedes Dreigestirn hat eine eigene "Ehrennadel".
Puute-Kaschöttche: abgesicherte Bereiche für Kinder mit Beeinträchtigungen oder aus sozialen Einrichtungen entlang des Zugwegs mit Toilette und ohne Gedränge
Rosenmontag und Rosenmontagszug: leitet sich vom Rosensonntag Lätare ab, mit einer goldenen Rose erinnert der Papst an die Passion Christi. Vergleiche Kölsch "Rus" (Rose) und nicht "rose" (rasen), d.h. es leitet sich von Rose ab und nicht von rasen! Die Begriffe Tulpensonntag, Nelkensamstag oder Veilchendienstag sind ebenfalls karnevalistische Ableitungen vom Rosensonntag. Rosenmontag ist der Höhepunkt des Straßenkarnevals, der Kölner Rosenmontagszug geht, er ist der größte und älteste Karnevalsumzug in Deutschland (seit 1823, damals noch bis 1832 "Maskenzug" genannt).
Rote Funken: (siehe "Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.V.")
Schunkeln: Brauch im Karneval, dabei schaukelt man nebeneinander eingehakt rhythmisch zur Musik seitwärts hin und her.
Session: Karnevalszeit vom 11. 11. bis Aschermittwoch mit Weihnachtspause vom 1. Advent bis zum 6. Januar, heute meist bis 2. Januar.
"Spinat mit Ei": Ehrengarde der Stadt Köln, Kosename wegen der grün-gelben Uniformen, Die Ehrengarde begleitet Bauer und Jungfrau, "Dem Bauer zur Wehr, der Jungfrau zur Ehr"
Stippeföttche: Funkentanz, paarweise Rücken an Rücken mit vorgehaltenem Gewehr (Knabüs) wird rhythmisch das Gesäß bewegt, das wird auch "wibbele" genannt. Persiflage auf das Militär.
Strüßje: Mini Blumensträuße, ursprünglich um die preußische Regierung und das Publikum zu besänftigen. Kurzlebige, cellophanierte Importware ist Umweltverschmutzung.
Stunksitzung: Alternative Karnevalssitzung mit aktuellen politischen Spitzen, ist heute fester Bestandteil des Sitzungskarnevals
Tanzmariechen (siehe Funkenmariechen): Name außerhalb der Funken
Tollität: Verballhornung von Majestäten, man spielt Herrschaft.
Traditionskorps: Ehrentitel vom Festkomitee, es gibt neun Traditionskorps: Rote Funken, Blaue Funken, Ehrengarde, Nippeser Bürgerwehr, Bürgergarde, Treuer Husar Blau-Gelb, Prinzengarde, Altstädter, und Reiterkorps Jan von Werth (Namen vereinfacht).
Trifolium: wörtlich Dreiblatt (Klee), anderer Name für das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau. Das Dreigestirn zahlt viel Geld für den Spaß, jedoch wer im Karneval Renommee gewinnt, kann später bessere Geschäfte machen.
Tusch: musikalisches Stilinstrument (Blechbläser) bei Sitzungen, markiert die Pointe eines Witzes oder zeigt den Zeitpunkt fürs Applaudieren an oder lenkt die Aufmerksamkeit auf die Bühne. Heute wird beim Tusch häufig auch ein bekannter Refrain gespielt, hier singen dann die Zuschauer mit.
Vier Botze: Straßenmusiker aus Köln, die als kölsche Musikgruppe überregional bekannt wurden: Hans Süper (Senior), Richard Engel, Philipp Herrig und Jakob Ernst, auch Colonia Quartett genannt. Bekannteste Interpretation "En d`r Kayjass nummero null" (ursprünglich "Drei Laachduve"). Zusammenarbeit mit Willy Schneider, Karl Berbuer und Toni Steingass. Hans Süper (junior) Colonia Duett, Thommy Engel (ehemals Bläck Föös) und Kai Engel (Brings) sind Kinder bzw. Enkel der Vier Botze.
Weiberfastnacht: Eröffnung des Straßenkarnevals durch die Altstädter. Dabei übernehmen die Frauen symbolisch die Macht. Ursprünge liegen bei den Marktweibern, die sich mit Kohlköpfen bewarfen und sich dabei die Haube vom Kopf rissen (Mötzenbestot). Weiber ist ein historischer Begriff für Frauen (auch in der Kirche) und wurde nicht als Beleidigung aufgefasst.
Wibbele: Rhythmische Gesäßbewegungen, s. auch "Stippeföttche"
Williamsbau: Veranstaltungshalle in der Nachkriegszeit, vom Circus Williams (ursprünglich Winterquartier) errichtet, 1956 abgerissen. Legendäre Überreichung eines jungen Geißbocks von Carola Williams an an Hennes Weisweiler und Franz Kremer auf einer Karnevalssitzung 1950. Nach der anschließenden Taufe hieß er "Hennes" und wurde zum Maskottchen des 1. FC Köln.
Willi Ostermann Gesellschaft Köln 1967 e.V.: Belebten die Sessionseröffnung am 11. November im Jahr 1969 wieder, damals noch am Ostermannplatz. Eröffnen heute traditionell den Karneval, die fünfte Jahreszeit, am 11.11.. Die Ostermanngesellschaft kümmert sich auch um die Grabstätte der Familie auf dem Melatenfriedhof.
Wolkenburg: Event-Location, nach dem Krieg Wiederaufbau und Vereinshaus des Kölner-Männer-Gesang-Vereins (KMGV) (siehe: Divertissementchen). Ursprünglich: Kloster, Hospital und Musikschule
Woosch: als Ersatzorden gibt es eine Flönz im Hänneschen Theater: "Herr Präsident, de Woosch". Die "Woosch" wird dann wieder abgenommen, da es nur eine gibt, und diese auch für den nächsten Künstler gebraucht wird.
Wurfmaterial: ursprünglich Erbsen, Kamelle, Süßigkeiten, Blumen, Spielsachen. Früher wurden viele Apfelsinen geworfen, heute wird mehr auf Sicherheit geachtet, ebenfalls sollen keine einfachen Bonbons mehr liegenbleiben
Zabel: Säbel, meist Holzsäbel, Griff und Spitze sind aus Messing, die Spitze ist entsprechend dem deutschen Waffengesetz entgratet.
Zillche: Nette Abkürzung für Cäcilia Wolkenburg den Kölner Männer Gesangverein (KMGV). siehe Divertissementchen
Zog ov Zoch (kurz gesprochen und geschlossenes o): a) Karnevalszüge, Donnerstags durchs Severinsviertel, Freitags Sternmarsch der Schull- und Veedelszog zum Alter Markt, Samstag diverse Vororte, Sonntags Schull- und Veedelszog und Köln-Brück, Rosenmontag: Dä Zoch kütt, Dienstags diverse Vororte b) Zug (Eisenbahn)
KÖLNER BÜTTENREDNER
Fritz Schopps (geb. 1946 Köln, gest. 2022 in Köln) Lehrer, Karnevalist und klassischer Büttenredner. Als "Et Rumpelstilzje" mit Filzhut wurde er auch überregional für seine bissigen Reimreden bekannt. Ehrentitel 2002: "Magister linguae et humoris Coloniensis" = Meister der kölschen Sprache und des kölschen Humors.
Hans Hachenberg (geb. 1925 in Bergisch Gladbach, gest. 2013 Bergisch Gladbach) Als "Doof Noß" verkörperte er mit lila Filzhütchen ein Kind aus einer Großfamilie, berichtete über Anekdoten aus dem turbulenten Familienleben. Sein Apell: "Maht üch Freud sulang et jeiht, et levve duurt kein Iwigkeit". Hans Hachenberg war ein ganz großer Typenredner. Ehrenbürger von Bergisch Gladbach und Platz in Paffrath.
Horst Muys (geb. 1925 in Mülheim a. d. Ruhr, gest. 1970 in Köln) Der Karnevalist konnte in den 1960er Jahren als Büttenredner unverklemmt über Bordellbesuche reden, das Publikum freute sich damals über die "Ferkeleien". Oft wurde er angestachelt: "Muys dun jet Peffer dran, der Saal es zu ruhig" oder "Muys gevv Peffer"! Gut ein Jahr hatte er Saalsperre, seine Reden waren für damalige Verhältnisse unter der Gürtellinie. Muys war oft Pleite, kassierte seine Gage in bar und erkannte dabei seinen Steuerfahnder im Publikum. Sein Grab befindet sich auf Melaten. Er war Bassist im Eilemanntrio, Duo Wildsäue. Ein erteiltes ihm Redeverbot wurde wieder aufgehoben.
Johannes (Hans) Süper jun. (geb. 1936 Köln gest. 2022 in Köln) Musiker, Komiker, Karnevalist und der größte Kölner Künstler. Hans Süper trat als Colonia Duett, später als Süper Duett jeweils mit Partner und Mandoline (Flitsch) auf. Biografie: "Mein Leben mit der Flitsch". Langjähriger Wohnsitz in Sülz. Vater Hans Süper sen. ("Vier Botze"). Verschiedene Gastauftritte bei Kölner Künstlern. "Häns" war ein beliebtes Kölsches Original und ein Mensch ohne Starallüren. Denkmal in Sülz geplant. Ruhestätte: Seebestattung
Karl Küpper (geb. 1905 in Düsseldorf, gest. 1970 in Köln) "D`r Verdötschte" positionierte sich als Büttenredner öffentlich gegen die Nationalsozialisten, verballhornte mehrfach den Hitlergruß, was ihm ein Redeverbot einbrachte, einer drohenden Verhaftung konnte er sich entziehen, da er freiwillig in der Wehrmacht als Komödiant im Fronttheater auftrat. Nach dem Krieg wetterte er gegen das bestehende System bzw. gegen die Alt-Nazis. Ein erneutes Redeverbot ist auch hier als Qualitätsmerkmal zu sehen. Am Ende seiner Rednerkarriere führte er in Kalk die Kneipe "Küppers Karl". Er war der einzige bekannte Karnevalist, der gegen das NS-Regime wetterte, daher ehren ihn in der Altstadt ein Platz und in Kalk eine Plakette.
Karl Schmitz-"Grön" (geb. 1896 in Köln, gest. 2000 in Köln) Als Typenredner verkörperte er etliche Figuren, sprach Kölsch. Vater war Jean Schmitz, bekannt als Schmitz-Gäl (wg. gelber Hautfarbe), sein Sohn war der "Grön(-schnabel)"
Kurzinfo: Karnevalstour durch köln - die Stadt in der fünften Jahreszeit
| Dauer: 1,5 Stunden | |
| Start: Bahnhofsvorplatz | |
| Ende: Fischmarkt | |
| Hinweis: Verfügbarkeit saisonal | |
| Anfrage Gruppen | |
| Öffentliche Führung |